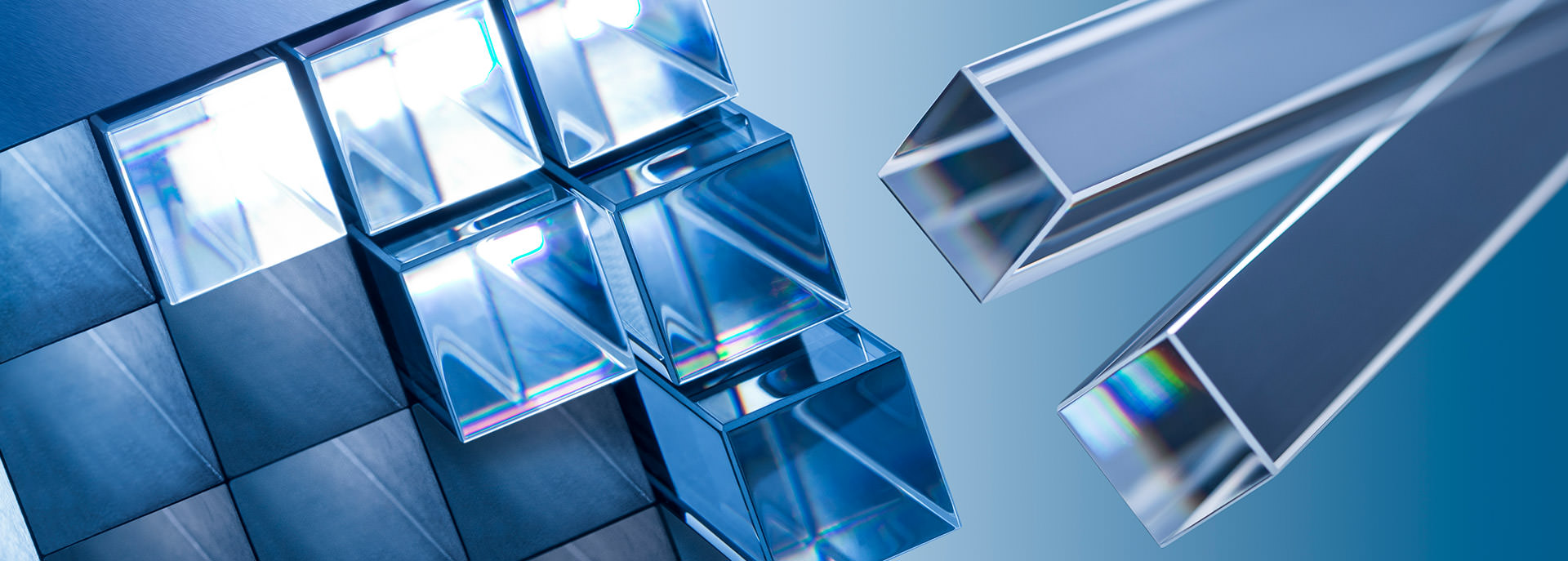Das Modul besteht aus insgesamt vier supraleitenden Hochfrequenzkavitäten und zwei ebenfalls supraleitenden Hochfeld-Solenoid-Linsen. Für den Zusammenbau mussten die Beschleunigerkavitäten bei fast vollständiger Abwesenheit von störenden Partikeln zu einem kompletten sogenannte „Beschleuniger-String“ zusammengeführt werden. Dazu nutzten die Wissenschaftler*innen den hochreinen Reinraum der ISO-Klasse 4 des HIM (ähnlich zu Räumen, die für die Herstellung von Computerchips verwendet werden). Auf der ebenfalls am HIM zur Verfügung stehenden Fertigungsstraße wurde dieser String aus der Reinraumumgebung ausgeschleust und anschließend zu einem kompletten Kryomodul zusammengesetzt.
Im Sommer 2023 wurde das knapp acht Tonnen schwere voll bestückte Modul mit einem Spezialtransporter von Mainz nach Darmstadt zu GSI/FAIR gebracht. Es folgten der Aufbau und die Integration des Kryomoduls und die Anbindung an die lokale Flüssig-Helium-Kryoversorgung. Nach erfolgreicher Kaltfahrprozedur konnten die einzelnen supraleitenden Beschleunigungskavitäten mit der neu errichteten Hochfrequenz-Leistungsversorgung in Betrieb gehen.
Im Dezember 2023 war es dann soweit: Nach fünfjähriger Entwicklungs-, Bau- und Inbetriebnahmezeit wurde im HELIAC-Kryomodul 1 erstmals Heliumstrahl vom GSI-Hochladungsinjektor auf eine Strahlenergie von ca. 6.2 Millionen Elektronvolt stabil und mit guter Transmission beschleunigt. Die zur Beschleunigung schwerer Ionen benötigten (bis zu dreifach höheren) Beschleunigungsgradienten stehen ebenfalls zur Verfügung. Außerdem konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, mit diesem Kryomodul die Strahlenergie über einen weiteren Bereich zu variieren, ohne dabei Teilchen zu verlieren. Dies ist ein erheblicher Vorteil des an der Universität Frankfurt entwickelten teilchendynamischen Konzepts, welches hier erstmals zur praktischen Anwendung kommt.
Der vorgeschlagene HELIAC, bei dem bis zu vier solcher Module Verwendung finden sollen, wird zukünftig Schwerionenstrahlen auf bis zu 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Die zur Teilchenbeschleunigung benötigte Energie wird durch den Einsatz der Supraleitung gegenüber konventionellen Beschleunigern um bis zu 90% reduziert. Die neuentwickelten Kryomodule tragen somit in erheblichem Umfang zur Energieeinsparung und damit zur CO2-Reduktion bei.
Nach Genehmigung, Finanzierungszusage und Implementierung des HELIAC-Projektes stehen die vollständig montierten und getesteten Module dann zukünftig den Wissenschaftler*innen zur Verfügung, um mit Dauerstrich-Schwerionenteilchenstrahl höchster Intensität u.a. kernphysikalische, kernchemische und materialwissenschaftliche Experimente durchzuführen.
Zu dem Erfolg haben insbesondere die Mitarbeitenden der GSI/FAIR-Abteilung Linearbeschleuniger und der Sektion ACID 1 des HIM, aber auch der weiteren beteiligten GSI/FAIR-Fachabteilungen, beigetragen.
Die hier beschriebene HELIAC-Prototypphase wird durch die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Europäische Union (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) finanziell unterstützt und gefördert.
Authors: M. Miski-Oglu, W. Barth, C. Pomplun (GSI, HIM, Johannes Gutenberg Universität Mainz)